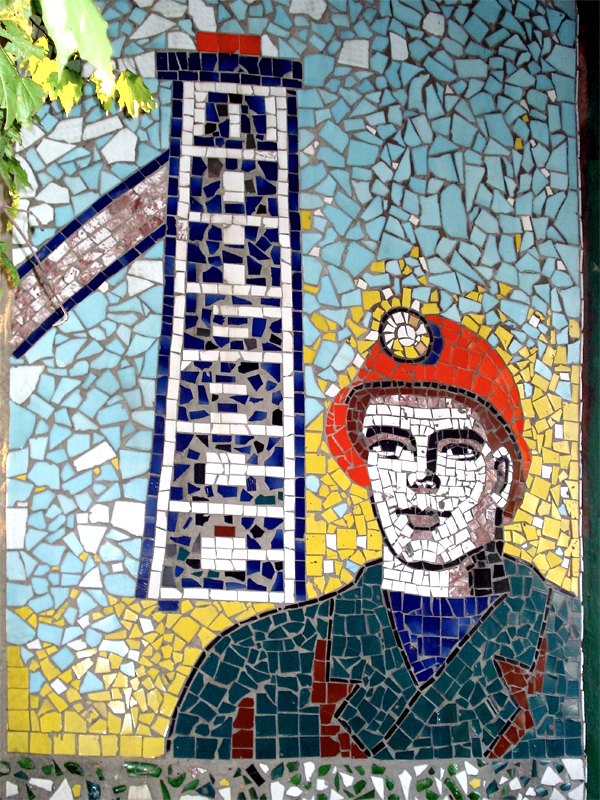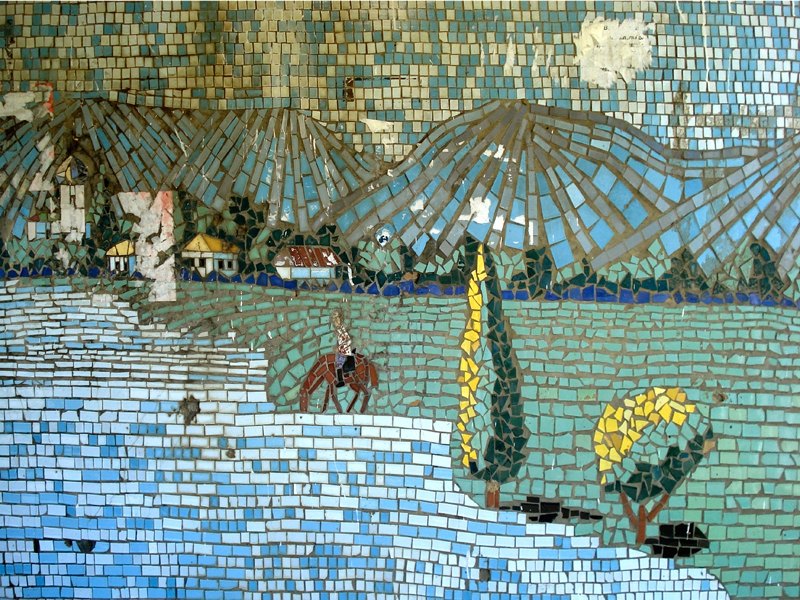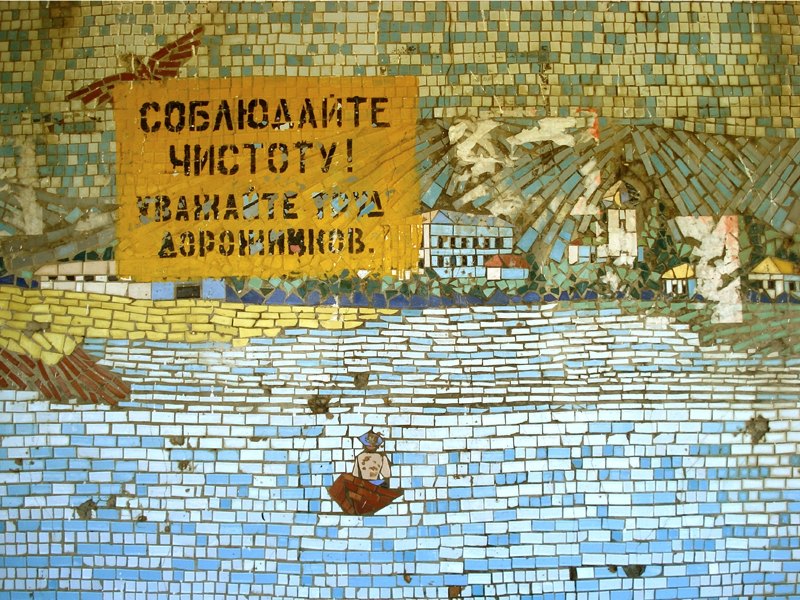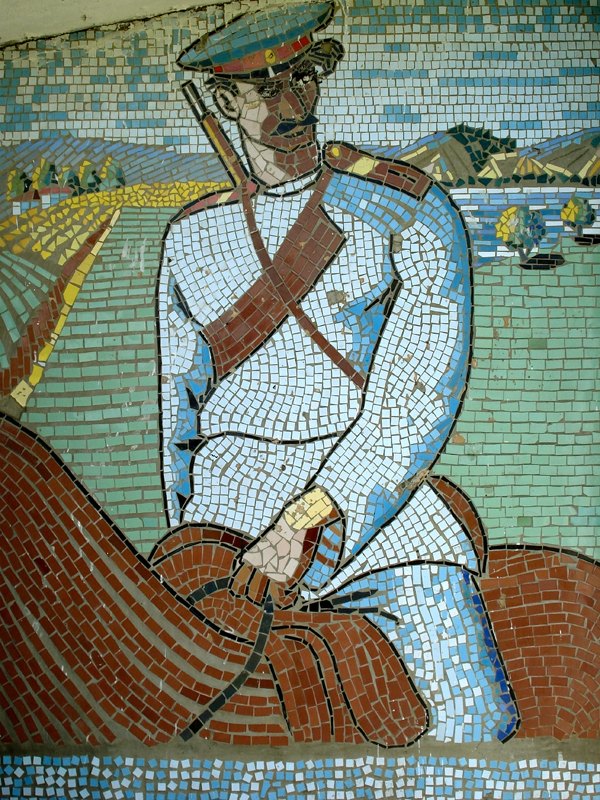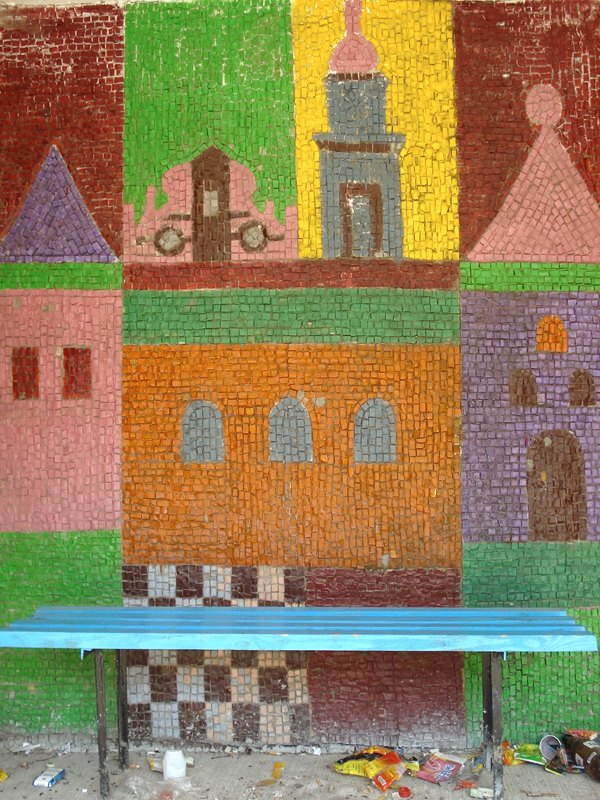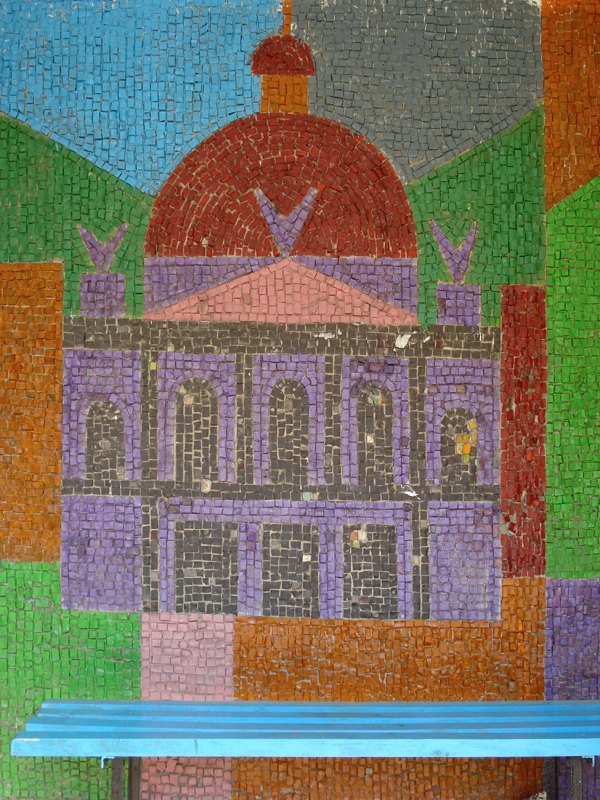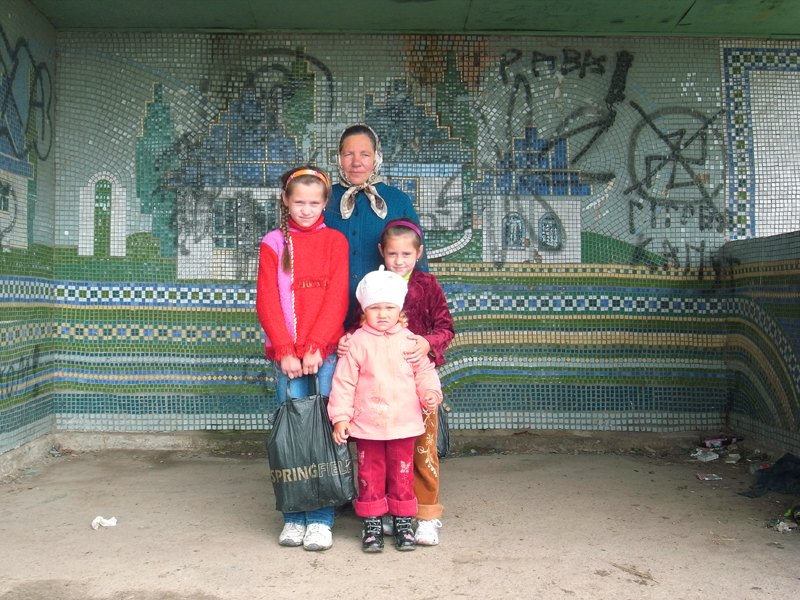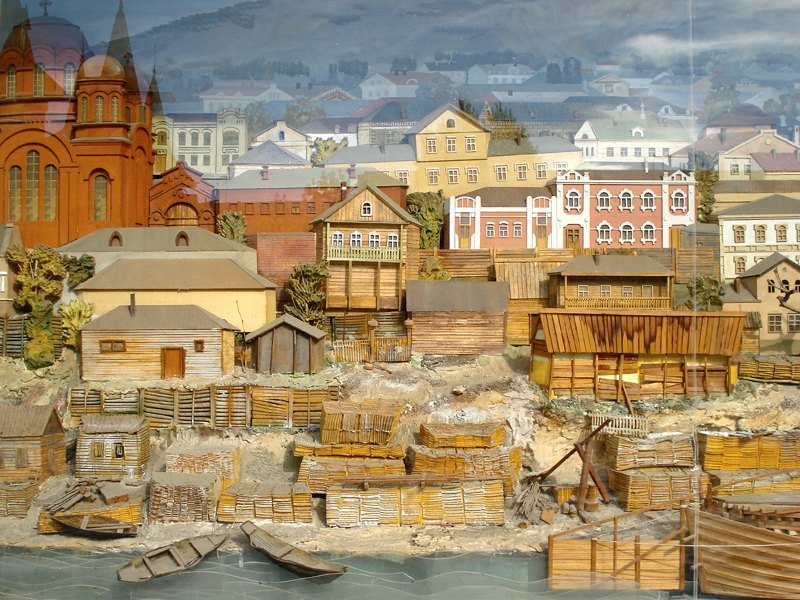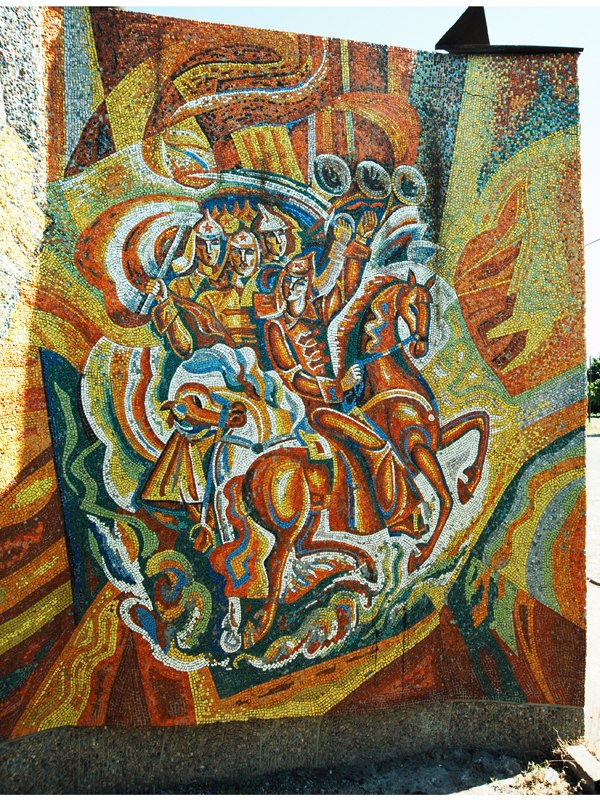Über unsere ausländischen Tagesgäste und ihre Vorliebe für „Stimmungen“ /Siehe Franz Kafka, Besuch im Bergwerk //
B., Oblast Charkiw, 01.10.2025
Unsere gestrige Dienstfahrt war erfolgreich, wir haben den Auftrag erfüllt, es gab keine besonderen Vorkommnisse. Wir haben Freunde im Wald besucht und ihnen nützliche Dinge gebracht. Und wir haben Militärschrott eingesammelt, den unsere Künstlerinnen verschönern und kreativ gestalten werden; mit den Erlösen aus dem Verkauf kaufen wir dann wieder nützliche Dinge für unsere Freunde im Wald.
Das Kind im Manne will natürlich spielen, also fahren, wenn es ein Auto oder ein Panzerfahrzeug sieht.
Während der Fahrt habe ich unter anderem über die Gefühlsduseleien im deutschen (nicht deutschsprachigen) Journalismus nachgedacht – diese Leidenschaft, DIE GEFÜHLE der Menschen in Katastrophen- und Kriegsgebieten zu interpretieren, angebliche Stimmungsschwankungen der betroffenen Bevölkerung zu erfinden, gar sich anzumaßen die „Stimmung im ganzen Land“ erkunden zu können, obwohl man nur wenige Tage dort gewesen ist.
Mustergültiges Beispiel von Julian Röpcke, der mit seinem BILD-Lagebericht in Berlin eigentlich gute Arbeit leistet und gestern auf X schrieb:
„Zehn Tage habe ich im Kriegsland Ukraine verbracht, darunter vier in unmittelbarer Nähe der Front. Dabei habe ich mit Soldaten, Politikern und Zivilisten gesprochen, die Putins Krieg jeden Tag am eigenen Leib erleben. Und ich muss sagen: Die Stimmung im Land hat sich geändert.“
Von mehr als 30 Millionen Menschen hat er täglich Maximum mit 30 Personen gesprochen, mit 300 in zehn Tagen, also mit weniger als 0,001 der Bevölkerung. Dass diese Personen dem ausländischen Reporter ihre Gefühle in zutreffender Weise schildern können und möchten, ist schon eine ziemlich gewagte Annahme.
Meine Erfahrung ist: auf die Frage nach der Stimmung im Land antworten die meisten ukrainischen Männer sarkastisch, insbesondere beim Militär: die Stimmung sei ausgezeichnet. Frauen antworten meistens seufzend, „schwer“ sei das Leben derzeit, seltener wie früher „normal“.
Wenn wir unter uns sind und keine Ausländer in der Nähe, dann sind wir Männer uns meistens einig, dass die Frage nach der Stimmung ein bisschen bekloppt und obszön ist – als sollte man gegen seinen Willen psychoanalytisch untersucht werden, wie ein Eindringen in gedankliche Intimsphären.
Ich wurde zuletzt in einem schriftlichen Interview ebenfalls nach der Stimmung gefragt und antwortete: «Diese Frage ist obszön. Der Krieg ist kein Karneval. Es herrscht natürlich
Bombenstimmung.»
Daraufhin schrieb der Mann: „Stimmung ist in der Sozialwissenschaft ja nicht nur eine Karnevasstimmung o.ä. Sondern umfasst breiter Befindlichkeiten und Einstellungnen.»
Woraufhin ich antwortete: „desto schlimmer für die Sozialwissenschaften, wenn sie den Begriff der Stimmung als taugliches Instrument für einen Kampf umd Leben und Tod definieren. Stimmungen wechseln in jedem Menschen mehrmals am Tag, im Kieg desto häufiger und heftiger; schwammiger kann ein Begriff kaum sein. Im Krieg müssen Sie schnell denken und schnell handeln, wenn Sie überleben wollen; Geschwätz und Geschwafel sind lebensgefährlich. Nach Befindlichkeiten dürfen Sie Kriegsveteranen fragen, wenn die das ausdrücklich wollen. Ein Interview soll ja keine Therapiesitzung ohne Einverständnis des Patienten sein. (dürfen Sie gern zitieren.)»
Daraufhin strich der Mann die Frage und meine Antworten und formulierte neu: „Die Ukrainer erleben nun seit 3 ½ Jahren einen Krieg mit Phasen des Schreckens und Phasen der Hoffnung. Wie wirkt sich dies auf die Gemütslage der Bevölkerung aus?»
Als ob der Begriff Gemütslage besser wäre als Stimmung. Ich weigerte mich, die Frage zu beantworten.
Diese Begriffe sind natürlich deshalb so populär, weil man mit ihnen alles Mögliche behaupten kann, ohne dass es nachprüfbar wäre. Man sagt nicht, was ist, sondern was man glaubt zu sehen und zu fühlen. Es ist Relotius- oder Leberwurst-Stil, wie man nach 1945 zu Theateraufführungen sagte, in denen oft über Leberwurst und Bratkartoffeln geredet wurde, weil das dem hungrigen Publikum gefiel.
Unsere ausländischen Tagesgäste merken offenbar nicht, dass man in der ukrainischen Kultur Gefühle diskreter äußert als in den freudianischen Kulturen des europäischen Westens. Auch im Krieg gilt es als unmännlich, dass Männer weinen, von Ausnahmen abgesehen, etwa auf einer Trauerfeier und in Erinnerung an getötete Freunde und Verwandte.
Themen: Russland - UkraineKommentare geschlossen.